Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, der Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und das Gen-ethische Netzwerk laden ein:
Gentech-Anbau in Brandenburg – Was droht? Erfahrungen aus Kanada – aktuelle Situation in Brandenburg
mit Percy Schmeiser (kanadischer Landwirt, in englischer Sprache mit Übersetzung) und Nora Mannhardt (Aktionsbündnis gentechnikfreies Berlin/Brandenburg)
am Dienstag, 9.5.2006 um 19:00 Uhr
im „Umweltforum Berlin“ (Alte Mälzerei)
10249 Berlin-Mitte, Friedensstrasse 91. ( http://www.umweltforum-berlin.de )
Percy Schmeiser spricht in Englisch, die Veranstaltung wird übersetzt.
Aus dem Einladungstext
Brandenburg ist in Deutschland das Land, in dem die transgenen Saaten ausgebracht werden. Für dieses Jahr sind etwa 800 Hektar (Deutschland ca. 1.700 ha) angemeldet. Die Situation in Brandenburg wird Nora Mannhardt vom Aktionsbündnis gentechnikfreies Berlin und Brandenburg darstellen. Was sind möglicher Gründe, wie organisiert sich der Widerstand?
Die Koexistenz konventioneller, ökologischer und gentechnisch veränderter Nutzpflanzen ist nicht möglich. Dies zeigen die Erfahrungen mit Kontaminationen in Kanada. Dort wird es vermutlich niemals mehr möglich sein, gentechnikfrei zu produzieren. Einige der dortigen Landwirte hat dies schon an den Rand des Ruins getrieben.
Percy Schmeiser, kanadischer Rapsbauer, berichtet über 10 Jahre Gentech-Anbau in Kanada und zeigt die Praktiken der Gentechnik-Konzerne auf. Schmeisser hatte den Gentechnik-Konzern Monsanto wegen Kontamination seiner Felder verklagt. Weil die kanadische Regierung und die Justiz voll auf der Seite der Gentechnik-Konzerne stehen, wurde in seinem und in vielen anderen Fällen gegen geltendes Recht und zugunsten der Industrie entschieden.
Der Fall verdeutlicht auch die Zusammenhänge zwischen Koexistenz, Kontamination und den so genannten Schutzrechten an geistigem Eigentum, das heißt der Patentierung – das heißt der Privatisierung von Saatgut.
Kanadische Farmer bringen Gentechnik vor UN-Menschenrechtsausschuss: Nun erhebt der kanadische Farmer Percy Schmeiser vor dem UN-Ausschuss für Menschenrechte in Genf Klage gegen die kanadische Regierung wegen Menschenrechtsverletzungen durch die Gentechnik in der kanadischen Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion (Stichtag 1. Mai 2006).
+++++++++++++
*In Kanada ist der Zug gentechnikfreier Produktion bereits abgefahren – aber bei uns ist es noch nicht zu spät!*
+++++++++++++
Hier ein Interview mit Percy Schmeiser aus der Mitgliederzeitschrift Umweltnachrichten (Dez. 2005) des Umweltinstitutes München. Das Interview führte Andreas Bauer.
Interview mit Landwirt Percy Schmeiser: „Eine ökonomische Katastrophe”
Im August 1998 verklagte der Gentechnik-Konzern Monsanto den kanadischen Bauer Percy Schmeiser, gentechnisch verändertes patentiertes Raps-Saatgut widerrechtlich angebaut zu haben: Schmeisers konventionelle und die Bio-Felder seiner Frau waren von genverändertem Saatgut verunreinigt. Zwei Gerichte verurteilten ihn zu einem Schadensersatz in Höhe von 100.000 Euro. Erst das oberste kanadische Bundesgericht stoppte den Konzern im Jahr 2004: Schmeiser wurde von Schadensersatzforderungen an den Konzern freigesprochen. Doch gleichzeitig befand das Gericht, dass Monsanto grundsätzlich im Recht sei und die Patentansprüche des Konzerns auch für kontaminierte Äcker gälten. 2005 hat Percy Schmeiser Gegenklage gegen Monsanto eingereicht, wegen Umweltverschmutzung und Zerstörung von Schmeisers gentechnikfreier Saatgutzüchtung.
Umweltinstitut München e.V. (UIM): Mr. Schmeiser, wie sind Ihre derzeitigen Beziehungen zu Monsanto?
Schmeiser: Ziemlich angespannt. Monsanto versuchte während der letzten Jahre, mich als Person zu diskreditieren, sowohl in den Medien als auch in meiner persönlichen Umgebung. Und das macht Monsanto nach wie vor. Zum anderen versuchen sie jetzt, mich mit Hilfe einer Knebel-Anordnung, der so genannten „Gag-Order“, ruhig zu stellen. Das ist eine Art gerichtlich verhängtes Redeverbot. Dadurch wäre mir das Recht genommen, über Monsanto zu sprechen. Dabei ist das einzige, was ich tue, darüber zu berichten, dass Monsanto mein gesamtes Ackerland kontaminiert hat.
UIM: Dagegen haben Sie jetzt Klage eingereicht.
Schmeiser: Ja, aber leider agiert Monsanto jetzt bösartiger als je zuvor. Der Grund ist meiner Meinung nach, dass der Konzern allein im letzten Quartal 125 Millionen US-Dollar Verlust gemacht hat. Und zwar ausschließlich deshalb, weil es sich, wie ein Journalist geschrieben hat, um eines der meistgehassten Unternehmen der Welt handelt, ein Unternehmen, das zentral an der Eliminierung der Rechte der Bäuerinnen und Bauern, und der Redefreiheit auf der ganzen Welt beteiligt ist. Letztes Jahr wurde Monsanto für die Dauer von zwei Jahren die Geschäftsausübung in Indonesien verboten, weil der Konzern für eine schnelle Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen die Behörden bestochen hatte. Auch in anderen Ländern gab es Korruption im Zusammenhang mit der Vermarktung von Monsantos Gen-Pflanzen.
UIM: Weswegen genau klagen Sie Monsanto an?
Schmeiser: Die erste Klage bezieht sich auf die Haftung für die Verunreinigung meiner Felder mit Genraps in den Jahren 1997 und 1998. Ich fordere Schadensersatz für die Zerstörung meines selbstentwickelten Raps-Saatguts, in dem 50 Jahre Forschung und Entwicklung stecken.
Vor zwei Monaten stellte ich zudem eine erneute Kontamination meiner Felder fest. Ich versuchte, Monsanto dazu zu bewegen, die Genrapspflanzen von meinem Feld zu entfernen. Monsanto war dazu nur unter der Bedingung bereit, dass ich einen so genannten „Release“ -Vertrag unterzeichne. Damit hätte ich allerdings für alle Zeiten Grundrechte, wie das auf freie Meinungsäußerung, an Monsanto verkauft. Der Vertrag hätte besagt, dass ich Monsanto nie wieder verklagen darf. Zweitens hätte ich auch alle bereits eingereichten Klagen gegen Monsanto zurückziehen müssen. Drittens hätte ich Zeit meines Lebens mit keinem Menschen mehr über Monsanto sprechen dürfen.
Zusätzlich hätte mir der Vertrag verboten, Raps und verwandte Arten, also zum Beispiel Senf, anzubauen. Denn Monsanto weiß, dass es dadurch erneut zu Kontaminationen meiner Felder durch gentechnisch veränderte Rapspollen kommen würde, der auch in verwandte Arten, wie eben Senf, auskreuzen kann. Kurzum, ich hätte sämtliche demokratische Rechte an der Eingangstür von Monsanto abgegeben. Ich bin Besitzer des Landes, ich zahle Steuern dafür, und alle Rechte dafür sollen an Monsanto gehen?
Wenn ich nach St. Louis, zur Konzernzentrale von Monsanto, fahren würde, um ihre Freilandversuche zu kontaminieren, und danach die Rechte auf diese Pflanzen reklamieren würde, hätte ich nach spätestens 24 Stunden ein Verfahren am Hals, das damit enden würde, dass man mich bis ans Ende meiner Tage einsperren würde.
Das Problem ist nach wie vor, dass die Menschen nicht darüber informiert sind, was passiert. In Kanada kann aufgrund der gentechnischen Verunreinigungen keine biologische Soja und kein biologischer Raps mehr angebaut werden. Das Grundrecht der Wahlfreiheit der Bauern ist zerstört.
UIM: Welche ökonomischen Auswirkungen hat der Anbau von Genpflanzen in Kanada?
Schmeiser: Der Anbau ist eine ökonomische Katastrophe. Viele Länder kaufen keine kanadischen Produkte mehr, die in irgendeinem Zusammenhang mit Raps oder Soja stehen könnten. Das betrifft neben den Bauern natürlich auch die nachgelagerten Industrien, also die Lebensmittelverarbeitung. Darüber hinaus kommt es zu einer Art Dominoeffekt: Auch die Nachfrage nach anderem Getreide aus Kanada ist zurückgegangen. Ganz konkret passiert folgendes: Die Rapserträge der kanadischen Bauern sind zurückgegangen, die Erträge sind von geringerer Qualität, für die Produktion müssen mehr Pestizide eingesetzt werden und das Einkommen der Bauern ist stark zurückgegangen. Durch die flächendeckende Kontamination ist auch die Wahlfreiheit der Bauern verloren.
UIM: Wie sieht es mit der sozialen Struktur in den ländlichen Gebieten aus? Hat sich auch diese durch den Anbau von GVO verändert?
Schmeiser: Auch das soziale Gefüge ist entgleist. Durch die Lizenzverträge mit Monsanto verlieren die Bauern das Grundrecht auf Redefreiheit. Die gesetzliche Lage verstärkt ihre Rechtlosigkeit noch zusätzlich. Sie müssen sehen, dass ein Bauer in Kanada in dem Moment schuldig gesprochen werden kann, wenn Monsantos Genraps auf seinem Feld gefunden wird. In meinem Fall hat das Gericht geurteilt, dass ein Bauer verpflichtet ist zu wissen, ob seine Ernte, sein Saatgut, oder sein Land mit Monsantos Genpflanzen kontaminiert ist. Wenn er nicht gentechnisch verändertes Saatgut aus einem Teil seiner Ernte anbaut, das mit Monsantos Genraps verunreinigt ist, verletzt er damit automatisch Monsantos Patent und kann von dem Konzern verklagt werden. Der einzige Ausweg besteht darin, gleich Monsantos Raps anzubauen. Denn in dem Moment, in dem sich Monsantos Gene auf seinem Feld befinden, kann Monsanto ihn dazu zwingen, seine gesamte Ernte zu vernichten. Wie soll ein Bauer wissen, ob sich Monsantos Raps auf seinem Feld befindet? Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist sein Feld mit Roundup zu spritzen: Wenn 98 Prozent seiner Pflanzen sterben, und zwei Prozent überleben, weiß der Bauer, dass zwei von 100 Pflanzen kontaminiert sind. Doch es gibt keinerlei Toleranz. Selbst eine einzige Pflanze würde genügen, um alle Rechte an Monsanto zu verlieren. Das Gericht sprach im Urteil meines Falls davon, dass die „bloße Anwesenheit“ von Monsantos patentierten Genpflanzen auf meinem Acker ausreichen würde, um Monsantos Ansprüche zu rechtfertigen. Der oberste kanadische Gerichtshof urteilte auch, dass es bedeutungslos sei, wie es zu der Verunreinigung der Felder kommt.
UIM: Hat sich auch das Verhältnis der Landwirte untereinander verändert?
Schmeiser: Natürlich. Es ist ein starkes Misstrauen gegeneinander entstanden. Der Grund ist, dass Monsanto Bauern oder andere Leute dafür belohnt, wenn sie z.B. einen Nachbarn anzeigen. Zudem besitzt Monsanto eigene „Polizei“-Kräfte, welche die Menschen auf dem Land aushorchen. Ich erzähle ihnen ein Beispiel aus meinem Dorf: An Tankstellen in Kanada werden auch Pestizide verkauft. Monsantos Leute gingen also zu einer Tankstelle in meinem Dorf und sagten dem Besitzer: „Sprich mit den Bauern, frag sie ob sie Raps gepflanzt haben. Falls sie Raps anbauen, frag sie, wie viele Hektar. Dann gib uns diese Informationen weiter.“ Im Gegenzug bekam der Tankstellenbesitzer gute Konditionen und Rabatte beim Einkauf der Pestizide von Monsanto. Das ist ein Weg, wie Monsanto an Informationen kommt. Seit diese Geschichte bei mir im Dorf herauskam, tanke ich natürlich woanders.
UIM: Können Sie noch von weiteren Fällen berichten?
Schmeiser: Es gibt viele bekannte Fälle. Einem befreundeten Geschäftsmann, der auch Bauer ist, passierte folgendes: Er baute 200 acre (80 ha) von Monsantos Genraps an und schloss mit dem Unternehmen einen so genannten Technologie-Vertrag über diese Fläche ab. Dieser sieht vor, dass ein Bauer pro acre 15 kanadische Dollar Patentgebühren an Monsanto zahlen muss. Bei seiner Versicherung waren die entsprechenden Flächen jedoch mit 208 acre veranschlagt. Monsantos Spitzel müssen auf irgendeine Weise Zugang zu diesen Unterlagen bekommen haben. Es fehlten also acht acre, und laut dem Technologie-Vertrag hatte er damit eine Lizenzgebühr von 15 Dollar pro acre unterschlagen, was einem „Gesamtschaden“ von 120 Dollar entspricht. Monsanto wollte jedoch eine Strafgebühr von 200 Dollar pro acre kassieren, die mein Bekannter natürlich nicht zahlen konnte. Monsanto verlangte nun für einen Verzicht auf ein Strafverfahren, dass mein Bekannter ebenfalls Spitzeldienste übernehmen sollte und Nachbarn melden, die von Kontaminationen wussten, diese aber aus Angst vor den finanziellen Forderungen Monsantos nicht melden wollten. Er ist darauf eingegangen, hat aber nie jemanden gemeldet.
Ich erzähle Ihnen noch von einem dritten Fall: Wenn Sie in Kanada Getreide verkaufen, müssen Sie Aufzeichnungen darüber in einem Buch dokumentieren. Dieses Buch ist Privatbesitz des Bauern. Da diese Aufzeichnungen von großer Wichtigkeit sind, hinterlegen es viele Bauern im Safe des örtlichen Getreidehändlers. Monsanto lädt nun diese Getreidehändler zu Wochendausflügen oder zum Essen ein und kommt so schließ-lich in den Besitz der Aufzeichnungen. Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, was diese Vorfälle mit dem sozialen Netz auf dem Land anrichten.
UIM: Der Presse kann man entnehmen, dass sich kanadische Bauern, vor allem Biobauern inzwischen wehren. Sie haben Genkonzerne wie Monsanto und Bayer verklagt. Wie beurteilen Sie die Aussichten, dass die Konzerne schuldig gesprochen werden?
Schmeiser: Die Vereinigung der Biobauern aus Saskatchewan (das Saskatchewan Organic Directorate) hat Monsanto und Bayer wegen der Kontaminationen auf Schadensersatz verklagt. Die Klage bezieht sich auf die Haftung für entstandene ökonomische Schäden, vor allem den Verlust von Exportmöglichkeiten, da kein biologischer Raps mehr angebaut werden kann. In erster Instanz haben die Bauern den Prozess verloren. Im Moment droht er bereits an der Frage zu scheitern, ob die Bio-Bauern als Vereinigung überhaupt das Recht haben, diese Klage einzureichen. Monsanto versucht den Prozess zu verschleppen. Schon jetzt hat er die Bio-Bauern 300.000 Dollar gekostet. Allein für die Frage nach der Zulässigkeit der Klage sind drei Jahre ins Land gegangen.
UIM: Welche Rolle spielt eigentlich die kanadische Regierung?
Schmeiser: Die kanadische Regierung unterstützt die Gentechnikindustrie bedingungslos. Monsanto arbeitet mit den zuständigen Behörden, z.B. der Lebensmittel- oder der Umweltbehörde, Hand in Hand. Ein Beispiel vom April 2004 mag Ihnen zeigen, wie eng die Verbindung ist. Monsanto stand damals kurz vor der Zulassung von gentechnisch verändertem Weizen. Dann kam heraus, dass die Regierung mit Monsanto ein Abkommen geschlossen hatte: In dem Vertrag stand, dass die Regierung für jedes Kilo Genweizen einen bestimmten Prozentsatz des Gewinns erhalten sollte.
Derzeit stehen wir in Kanada auch vor einer Überarbeitung der Saatgut-Gesetzgebung, dem Seed Sector Review. Die Vorschläge der Gentechnikindustrie für dieses Gesetz wurden bislang nur noch nicht umgesetzt, weil Wahlen bevorstanden. Mit diesem Gesetz würde die Saatgutindustrie die totale Kontrolle über die Landwirtschaft übernehmen. Denn der zentrale Punkt des Gesetzes ist, dass es den Nachbau von gekauftem Saatgut schlichtweg verbietet. Dieser Passus bezieht sich nicht nur auf Getreide, sondern auch auf Gartenblumen oder Bäume. Damit würden nicht nur Bauern, sondern auch Gärtner und Forstwirte total entrechtet. Die Industrie versucht, dieses Gesetz ohne öffentliches Aufsehen durchzubekommen. Die Situation ist sehr ernst.
Und dennoch: Seit einigen Jahren stockt die Zulassung neuer Gentechnikpflanzen. Bis heute gibt es nur sehr wenige kommerzialisierte Arten, vor allem Raps, Mais, Soja und Baumwolle. Was die Einführung weiterer GVO verhindert hat, war nicht die Umweltproblematik und nicht die gesundheitlichen Effekte, sondern der grandiose ökonomische Misserfolg. Die Bauern merken langsam, dass sie betrogen wurden.
UIM: Warum wächst die Anbaufläche in Kanada dann nach wie vor? Warum bauen die Bauern überhaupt noch gentechnisch verändertes Saatgut an?
Schmeiser: Viele haben Angst. Sie wissen, dass sie von Monsanto jederzeit verklagt werden können, denn ihre Felder sind genauso kontaminiert wie meine. Der einzige Ausweg sich vor Klagen zu schützen ist gleich Monsantos Genpflanzen anzubauen.
Das Interview führte unser Mitarbeiter Andreas Bauer.
Erschienen in unserer Mitgliederzeitschrift Umweltnachrichten, Ausgabe 102 / Dez. 2005
„Was damit geschaffen wird, ist eine Kultur der Angst“
Am 28. Oktober 2005 hielt Percy Schmeiser in Zürich den Vortrag, denn Sie hier ( http://www.umweltinstitut.org/download/vortrag_schmeiser_zuerich_okt2005.pdf ) als PDF-Datei herunterladen können.
Technologievertrag in Originalfassung und übersetzt als PDF-Datei zum Herunterladen ( http://www.umweltinstitut.org/download/technologievertrag_monsanto.pdf )

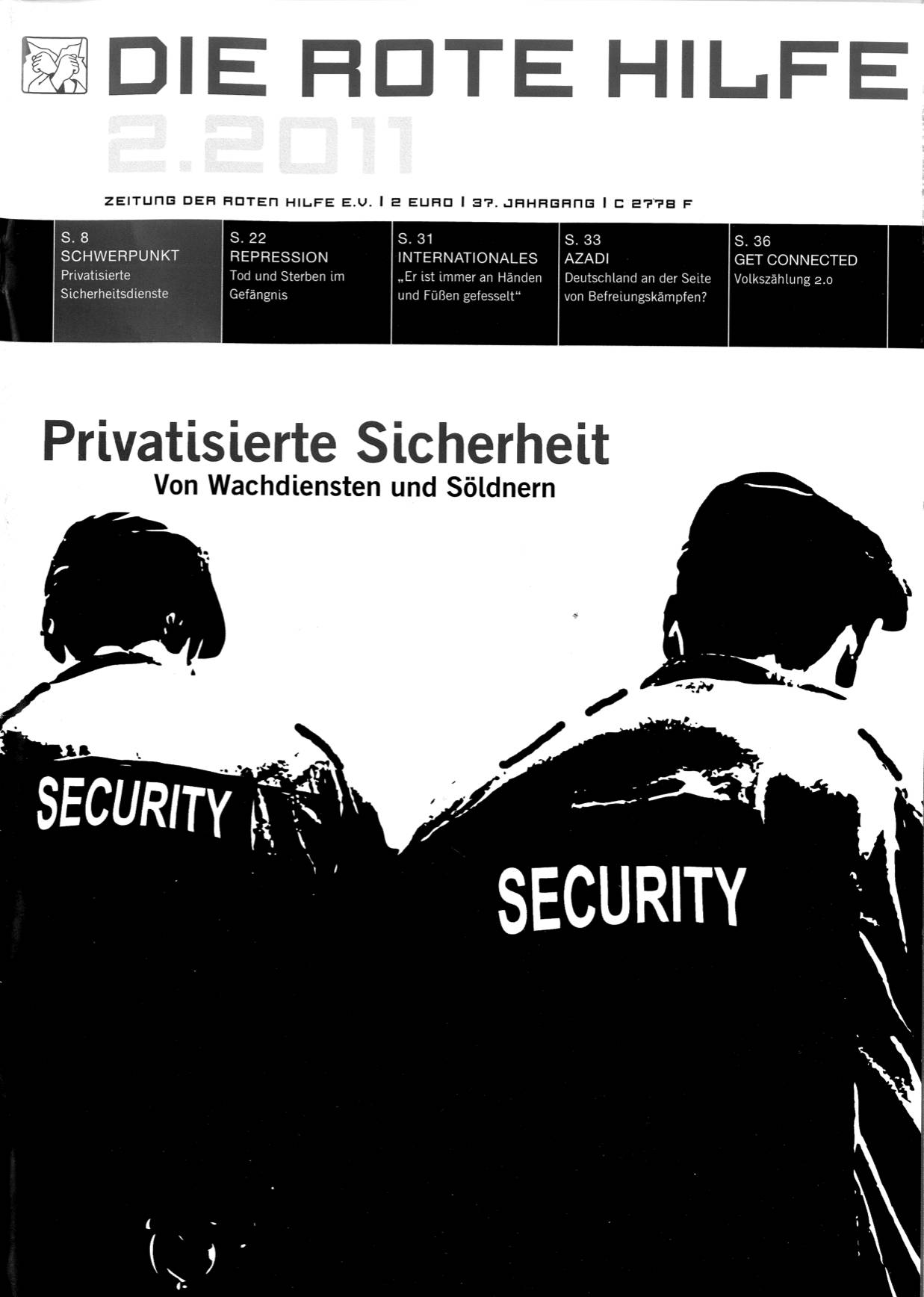




 Die
Die